Großbritannien geht positiv und voller Selbstvertrauen in die Austritts-verhandlungen mit der EU. Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit elf Jahren nicht mehr und Theresa May ist einer der populärsten Premierminister der vergangenen Jahrzehnte. Sie verspricht, einen 100-prozentigen EU-Austritt auszuverhandeln.
Text: Klaus Faißner
"Wir verlassen die Europäische Union, aber nicht Europa", erklärte die britische Regierungschefin Theresa May bei der Vorstellung ihrer Ziele für die EU-Austrittsverhandlungen mit Brüssel. "Deshalb suchen wir eine neue und gleichberechtigte Partnerschaft - zwischen einem unabhängigen, selbstverwalteten, global orientierten Großbritannien und unseren Freunden sowie Verbündeten in der EU." May hat allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken: Mit 494 zu 122 Stimmen übertrugen ihr Anfang Februar die Parlamentarier die Vollmacht, die Gespräche mit der EU im März zu beginnen. Sie stimmten für keine Kuschelgespräche, sondern für harte Verhandlungen, die Großbritannien in die Unabhängigkeit zurückführen sollen. Das bedeute, dass man nicht halb aus der EU austreten werde. "Nein, Großbritannien verlässt die Europäische Union. Und mein Job ist, das für unser Land passende Abkommen zu bekommen."
May populär, Wirtschaft läuft gut
Das scheinen die Briten May auch zuzutrauen: Sie ist der populärste konservative Premierminister seit den 1950er-Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur Press Association ermittelte. Und sie führte die nach dem Brexit-Referendum im vergangenen Juni noch zerrütteten Konservativen klar an die Spitze. Laut Umfragen lagen sie Anfang Februar mit 42 Prozent deutlich vor der Arbeiterpartei (Labour) mit 27 Prozent. Die EU-Austrittspartei UKIP, ohne die es den Brexit wohl nicht gegeben hätte, kam auf zwölf Prozent, die Liberaldemokraten als einzige eindeutige EU-Befürworter brachten es gar nur auf zehn Prozent.
Die Stimmung im Land ist positiv. Die Weltuntergangsszenarien unmittelbar nach der Brexit-Volksabstimmung im Juni des Vorjahres haben sich bislang als glatte Lügen herausgestellt. Regelmäßig liest man in den deutschsprachigen Medien, dass sich die britische Wirtschaft "trotz des Brexits" gut entwickelt. Doch neutrale Beobachter - wie etwa alles roger? - prophezeiten von Anfang an, dass sich das Land "wegen des Brexits" gut entwickeln werde. Und sie behielten bislang recht: Die Arbeitslosigkeit ist derzeit auf dem niedrigsten Stand seit elf Jahren, das Wirtschaftswachstum lag mit 0,6 Prozent auch im letzten Quartal 2016 über den Erwartungen und die britische Autoproduktion stieg 2016 um 8,5 Prozent auf 1,72 Millionen Autos an und lief damit so gut wie das letzte Mal vor 17 Jahren.
Folgendes Sonderangebot wurde exklusiv für Sie ausgesucht:
Alles roger? ist durch Click-Provision beteiligt.
Einwanderung regeln, eigene Gesetze machen
Ein zentraler Punkt bei den Verhandlungen mit der EU wird die Kontrolle der Einwanderung sein: "Im vorigen Jahrzehnt haben wir Rekordwerte an Nettoeinwanderung nach Großbritannien gesehen und allein die Menge hat Druck auf öffentliche Dienstleistungen wie Schulen ausgeübt, hat die Infrastruktur belastet, insbesondere den Wohnbereich, und führte zu einer Abwärtsentwicklung bei den Löhnen der Arbeiter", erklärte May. Aus eigener politischer Erfahrung wisse sie, dass man Einwanderung nicht generell kontrollieren kann, wenn es einen freien Verkehr von der EU nach Großbritannien gebe. Auf jeden Fall werde man sich weiter bemühen, ein attraktives Land für die Klügsten und Besten aus dem Ausland zu sein. Der Brexit sei auch wegen der Gesetzgebung wichtig: "Die EU zu verlassen bedeutet, dass unsere Gesetze in Westminster, Edinburgh, Cardiff und Belfast gemacht werden. Und diese Gesetze werden nicht von den Richtern in Luxemburg beurteilt, sondern von Gerichten quer durch dieses Land."
Abkommen: gut oder gar nicht
Die Wirtschaft soll durch Handelsverträge mit Ländern in aller Welt angekurbelt werden und auch mit der EU wird ein Freihandelsabkommen angestrebt. Die Zeit der ausgiebigen Zahlungen nach Brüssel sei jedenfalls vorbei und ihre Regierung werde dafür sorgen, dass die Stimmen der Arbeiter gehört werden. Der Austritt soll Sicherheit geben und die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien ebenso garantieren wie die Rechte der britischen Staatsbürger in der EU. May machte aber eines klar: "Kein Abkommen ist besser für Großbritannien als ein schlechtes Abkommen." Gäbe es kein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien, würde der Austritt laut EU-Vertrag automatisch zwei Jahre nach Verhandlungsbeginn erfolgen. Es würden die Regeln der Welthandelsorganisation WTO gelten, die freien Handel mit geringen Einschränkungen sicherstellen.
Großes Lob erntete May von Nigel Farage, der als Chef der britischen EU-Austrittspartei UKIP jahrelang so viel Druck auf die Regierung aufgebaut hatte, dass es zu einer Volksabstimmung kam: Er hätte sich nie vorstellen können, je solche Worte von einem britischen Premierminister zu hören, erklärte er. Volle Unterstützung erhält May vom neuen US-Präsident Donald Trump, den sie wenige Tage nach dessen Amtseinführung besuchte. Der Brexit werde eine "wundervolle Sache" für Großbritannien sein, erklärte Trump. Die USA und Großbritannien verstünden, dass Regierungen auf die arbeitende Bevölkerung eingehen und ihre eigenen Bürger repräsentieren müssen. Erstmals seit langer Zeit nannten westliche Staatschefs "Souveränität" und "Selbstbestimmung" von Völkern und Staaten als positive Werte.
Vorbild für Österreich?
Menschen schöpfen also Hoffnung. Nervös sind dagegen Vertreter des Großkapitals und der Großindustrie, wie Hans Peter Haselsteiners Kampagne "Kommt Hofer, kommt Öxit, kommt Arbeitslosigkeit" im Vorjahr zeigte. Seriöse Studien machen sichtbar, dass gerade Durchschnittshaushalte vom EU-Austritt finanziell stark profitieren würden (alles roger? berichtete). Ob Österreich den gleichen Mut wie Großbritannien hat, wird die Zukunft zeigen. Die EU-Ablehnung ist hierzulande jedenfalls größer als in fast allen anderen EU-Staaten: Nur 26 Prozent der Österreicher vertrauen der EU, ein Minus von sechs Prozentpunkten im Vergleich zum Frühjahr 2015. EU-weit sind es immerhin noch 34 Prozent.
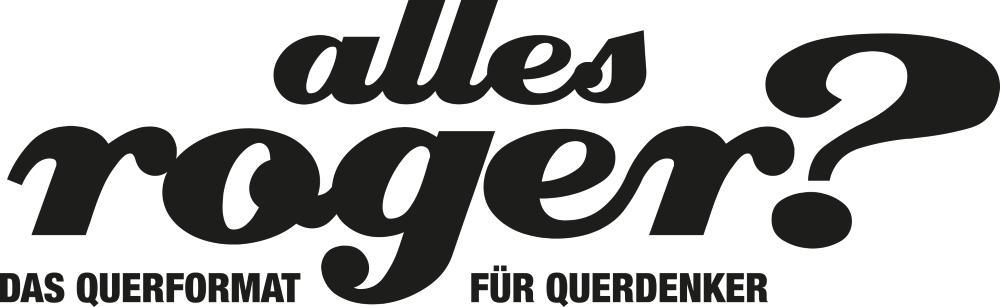






 Klicken zum vergrößern
Klicken zum vergrößern

